TreeNet. Daten und Analysen der ersten fünf Messjahre
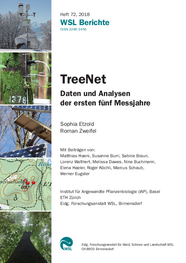
Authors:
Sophia Etzold, Roman Zweifel, Matthias Haeni, Susanne Burri, Sabine Braun, Lorenz Walthert, Melissa Dawes, Nina Buchmann, Elena Haeler, Roger Köchli, Marcus Schaub, Werner Eugster
Series:
WSL Berichte
72
Publishing year:
2018
Amount:
70 Pages
Download
Quote:
Etzold S., Zweifel R., Haeni M., Burri S., Braun S., Walthert L., … Eugster W. (2018) TreeNet. Daten und Analysen der ersten fünf Messjahre. WSL Berichte 72. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 70 S.
Available languages: